Die nordschauenden Abstürze vom Gebiet zwischen Herrenalm und Grubwiesalm hinab zum Herrenalmbach bzw. Taglesgraben im östlichen Dürrensteingebiet waren bis zum Jahr 2012 noch völlig "höhlenfrei". Erst mit der Auffindung der Daglis-Quellhöhle (1815/396), siehe HKM 11-12/2013, setzte die höhlenkundliche Bearbeitung dieses Areals ein. Zur Zeit sind fünf Objekte katastermäßig erfasst, davon drei Mittelhöhlen. Die neueste Entdeckung, die Kegelstatthöhle, öffnet sich am Fuß der mächtigen Felsabstürze des Kegelstattkogels, sowie etwa 100 Höhenmeter oberhalb der noch nicht zur Gänze erforschten Feuersteinmauerhöhle (1815/407).
Kegelstatthöhle (1815/413)
Basisdaten:
L 217 m, H 19 m (-2,5 m, +16,5 m), HE 43 m, Sh 1330 m, ÖK72.

Eingang der Kegelstatthöhle (1815/413), Foto: R. Fischer am 7.11.2015
Lage:
Etwa 430 m ONO der Herrenalmhütte, sowie 220 m NW der Kote 1441 am Kegelstattkogel im östlichen Dürrensteingebiet, ca. 8 km südöstlich von Lunz am See.
Zustieg:
Der Zustieg erfolgt von einem Parkplatz (Sh 704 m) bei der Einmündung des Taglesbachs in die Ois zwischen Langau und Holzhüttenboden. Man folgt dem markierten Wanderweg (Alpinweg) auf der orographisch linken Talseite bis zur Herrenalm (Sh 1327 m). Von der Jagdhütte auf der Herrenalm führen Steigspuren ostwärts Richtung Grubwiesalm. Diesen folgend erreicht man nach 200 m einen großen Wiesenkessel an dessen Nordrand man den Almzaun übersteigt und sich in die Einsattelung zwischen einer nördlich liegenden Kuppe und dem ostwärts anschließenden Kegelstattkogel (1441 m) hält. Man geht in der Einsattelung gut 200 m nach Norden bis man zu den Abstürzen der Feuersteinmauer hinab zum Herrenalmbach kommt. Hier wendet man sich nach rechts (Osten) zum Fuß der mächtigen Felswände des Kegelstattkogels. Entlang des Wandfußes sehr steil absteigend, erreicht man nach etwa 40 m den Höhleneingang. Bequemer zur Höhle gelangt man auf einem, den Steilhang auf Höhe des Einganges, querenden Wildwechsel.
Beschreibung:
Eingangsbereich (20 m Ganglänge): Das nordschauende, schrägprofilierte Portal öffnet sich unter einem langgezogenen, weit ausladenden Überhang. Der eigentliche Eingang ist 5 m breit und etwa 3 m hoch und leitet über etwas Blockwerk hinab in die 10 m lange und 4 bis 5 m breite Eingangskammer. Der Boden besteht in der ersten Hälfte des Raumes aus Humus und Gämsenlosung, dahinter, nach einem weiteren kleinen Abstieg über Blockwerk aus Bruchschutt und Blöcken. An der westlichen Raumbegrenzung befindet sich ein 4 m langer, fortsetzungsloser Schluf (tiefster Punkt der Höhle), die Hauptfortsetzung setzt an der Ostseite an, wo eine Blockbarriere überwunden werden muss.
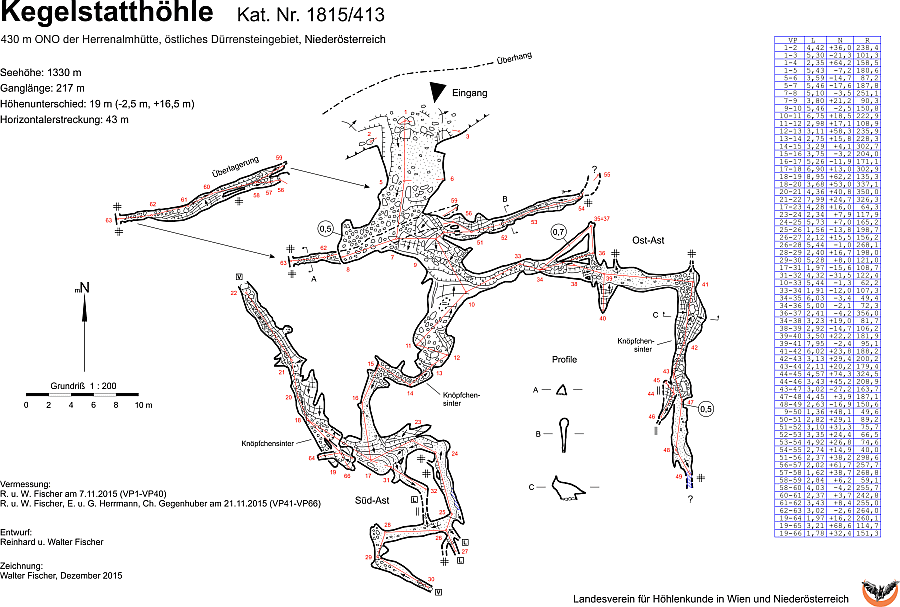
Überlagerung (36 m Ganglänge): Auf den bis 2 m aufragenden Blöcken stehend, ist es möglich, eine in Richtung ONO ziehende Canyonstrecke zu erklettern. In der ersten Hälfte des steil aufwärts führenden, 0,5 m bis 1 m breiten und bis 3 m hohen Canyons erschweren einige Naturbrücken die Befahrung, im Mittelteil ist die Strecke im Bodenbereich unschliefbar schmal. Nach 15 m wird der Gang bei einer Engstelle mit Linksknick durch einen Klemmblock zusätzlich verengt, sodass ein Weiterkommen nicht möglich ist. Jenseits des sperrenden Blockes ist wieder ein geräumigerer Gangabschnitt einsehbar, außerdem wurde hier eine bergwärts gerichtete Wetterführung festgestellt.
Gleich zu Beginn der Canyonstrecke kann über einige Stufen 5 m hoch in eine Überlagerung der Eingangskammer geklettert werden. Nach Übersteigen eines Felsgrates befindet man sich in einem ebenfalls WSW-ONO orientierten, schmalen Gangstück. Dieses besitzt am 4 m tiefer liegenden Grund eine durch einen großen Klemmblock zweigeteilte Öffnung zum darunter liegenden Eingangsraum. Ein über die westwärts steil ansteigende Sohle herabfließendes bescheidenes Gerinne macht sich im Eingangsraum als Tropfwasser bemerkbar. Nach insgesamt 15 m endet der zuletzt niedrige Gang an einer unschliefbaren Querkluft.
Ost-Ast (63 m Ganglänge): In einer Raumerweiterung nach der Blockbarriere gabelt sich die Hauptfortsetzung in zwei Äste (bei VP10). Südwärts ansteigend ist ein verzweigtes, teils engräumiges Kluftsystem zugänglich, in östliche Richtung zieht ein anfangs geräumiger Canyon weiter. Der Canyon ist gut einen Meter breit und bis zu 4 m hoch und weist am Boden einen etwa 0,5 m breiten und ebenso tiefen Einschnitt mit Blöcken und Bruchschutt auf. Nach 10 m teilt sich der Gang bei grobem Bodenblockwerk in drei Äste, die sich jedoch nach kurzer Strecke an einer quer verlaufenden Kluft wieder vereinigen. Der schlufartige, nördliche Ast weist ein Canyonprofil mit etwa 0,7 m Höhe und 0,4 m Breite auf und knickt nach 5 m entlang der Querkluft spitzwinkelig nach Süden. Der mittlere Ast mündet als Kriechgang mit Blockboden nach 3 m in die Querkluft. Der südliche, geräumigste Ast stellt die direkte Verlängerung des Hauptcanyons dar, allerdings muss ein 2 m hoher Wall aus festem Fels überklettert werden, ehe man auch hier zur Querkluft gelangt, die sich in südliche Richtung als ansteigende Spalte noch 3 m weit fortsetzt. Nun ändert sich der Charakter des W-O verlaufenden Ganges. Die Raumhöhe sinkt auf 1 m ab, der Boden besteht aus plattigen Lehmstrukturen und Wasserstandsmarken an den Wänden deuten auf eine temporäre, bis 10 cm tiefe Wasseransammlung hin. Nach Durchkriechen dieses "Halbsiphons" steigt die Raumhöhe kontinuierlich auf 2 m an, und der Gang knickt nach 8 m rechtwinkelig nach Süden um. Bei gleichbleibender Raumhöhe gelangt man über Blöcke ansteigend nach 6 m zu einer 1,5 m hohen Stufe aus Blockwerk. Im Deckenbereich befinden sich hier markante Knöpfchensinterbildungen. Eine Raumerweiterung mit Versturzboden oberhalb der Stufe weist eine Höhe von bis zu 7 m auf, verliert sich im Deckenbereich aber in unschliefbare Spalten mit etlichen bedrohlich hängenden Klemmblöcken. Am Südende der 4 m langen, bis knapp 2 m breiten Erweiterung befindet sich einerseits 3 m über dem Boden der Ansatz einer aufwärtsziehenden Kluftstrecke, die jedoch bereits nach 3 m unbefahrbar schmal wird. Andererseits setzt im Bodenbereich ein Schluf an, der in einen 1 m hohen, bis 1,5 m breiten, weiter südwärts führenden Kriechgang mit Lehmboden leitet. Nach 7 m verengt sich die Strecke hinter einem kleinen Lehmwall und der Boden der unbefahrbar eng weiterführenden Kluft wird von einer Wasseransammlung eingenommen.
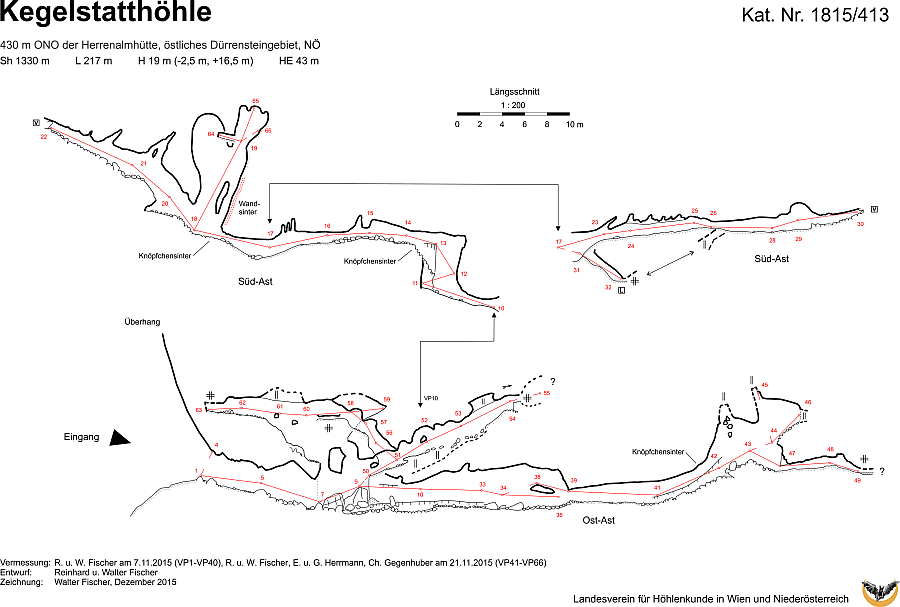
Süd-Ast (98 m Ganglänge): Der Süd-Ast setzt bei VP10 mit einer 4 m breiten, steil ansteigenden Felsplatte mit mehrere cm durchmessenden Fließfacetten an, die in einen Kriechgang übergeht. Dieser mündet nach 5 m in einen schlotartigen Raum mit etwa 3,5 m Durchmesser auf dessen blankem Felsboden etliche Versturzblöcke lagern. Knapp 2 m über dem Grund mündet an der südwestlichen Raumbegrenzung ein anfangs steil ansteigender und nur durch einen Felsgrat vom Raum getrennter Canyon ein. Nach einer Rechtsbiegung mit Knöpfchensinter an Wänden und Boden befindet man sich in einem 1 m bis 1,5 m hohen Abschnitt mit Blockboden, der nach wenigen Metern bei einer Kluftkreuzung einen 90-Grad Knick nach links aufweist, sich ab hier als Kriechgang mit Lehmboden fortsetzt und in eine abwärtsführende Lehmkammer leitet. Die bis 2,5 m hohe, 4 m mal 3 m messende Kammer mit dreieckförmiger Grundfläche fällt über einen Lehmwall steil zu ihrem tiefsten Punkt an der südlichen Raumbegrenzung ab. Sie besitzt an jeder ihrer drei Ecken eine Fortsetzung. An der Westseite setzt ein aufwärts führender, blockiger Schluf mit Knöpfchensinterbildungen an, der unvermittelt in eine hohe Kluft mündet. Die mit Wandsinter geschmückte Kluft ist durch eine Naturbrücke in zwei parallele Äste geteilt und kann zu einer kleinen Deckenöffnung in 8 m Höhe erklettert werden. Darüber befindet sich ein Kolkraum mit ca. 2 m Durchmesser und einem kurzen Schlufansatz. An der Decke der 3 m hohen Erweiterung befindet sich der höchste Punkt der Höhle (+16,5 m). Die Kluft selbst zieht mit 3 m bis 4 m Höhe in Richtung NNW über Blöcke aufwärts weiter und wird oberhalb einer 3 m hohen, unangenehmen Kletterstelle zunehmend niedriger und endet mit 1 m Höhe und ebensolcher Breite nach insgesamt 20 m an einem formatfüllenden Klemmblock im tagnahen Versturz. An der Südseite der Lehmkammer setzt eine steil abwärtsführende, engräumige Röhre mit feuchtem Lehmboden an, die nach 4 m verlehmt endet (VP32). Im östlichen Eck der Kammer beginnt oberhalb einer glitschigen Lehmrutsche eine kleinräumige Zickzack-Strecke mit 25 m Ganglänge. Der 1 m breite Gang mit dicker Lehmauflage ist anfangs gebückt begehbar, nach 8 m sinkt die Raumhöhe bei einem Rechtsknick auf ca. 0,5 m ab. Beim Knick befinden sich einige Gangansätze, die allesamt verlehmt oder unschliefbar eng sind. Eine nordwärts ziehende Spalte besitzt über einen unschliefbaren Abbruch eine Verbindung mit dem Lehmsunk bei VP32 (Steinwurf). Die Raumhöhe des weiterziehenden Kriechgangs steigt wieder kontinuierlich an und erreicht nach dem nächsten Knick, diesmal nach links, an einer Verwerfung etwa 2,5 m. Es folgt noch ein leicht ansteigender, enger werdender Schluf mit Blockboden, der nach 4 m bei einigen sperrenden Blöcken endet.

Knöpfchensinter im Ost-Ast der Kegelstatthöhle (1815/413), Foto: W. Fischer am 7.11.2015
Beobachtungen:
Gestein: Die geologische Karte, Blatt Nr. 72, der Geologischen Bundesanstalt, Ausgabe 1997, weist für den Kegelstattkogel einen schmalen Streifen "Hierlatzkalk (Lias)" aus, die nördlichen Abstürze werden als "Dachsteinkalk (Nor-Rhät)" bezeichnet. Der knapp südlich gelegene Bereich von Obersee, Herrenalm bis Grubwiesalm besteht aus der sogenannten Obersee-Brekzie. Der Höhleneingang liegt laut der geologischen Karte beim Übergang von Dachsteinkalk zum darüber liegenden Hierlatzkalk. In der Höhle ist das Gestein teils rötlich gefärbt, schwarze Hornsteineinlagerungen sind vorhanden. Die Höhle dürfte im Grenzbereich von Dachsteinkalk, Hierlatzkalk und bunter Obersee-Brekzie angelegt sein. Das Vorhandensein von Obersee-Brekzie in weiten Teilen der Höhlenwände und -decke wurde von Lukas Plan anhand der Fotodokumentation mit "ziemlicher Sicherheit" bestätigt.
Wasserführung: Im überlagernden Canyon der Eingangskammer wurde am 21.11.2015 ein bescheidenes Gerinne beobachtet, das in der Eingangskammer als Tropfwasser zutage tritt und im Bodenschutt versickert. Im Ost-Ast befinden sich zwischen VP39 und VP41, etwa 10 cm über dem trockenen Lehmboden Wasserstandsmarken an den Wänden. Mit einigen unschliefbaren, nördlich ansetzenden, abwärts führenden Spalten wären hier auch Abflussmöglichkeiten vorhanden. Bescheidene Wasseransammlungen befinden sich zwischen dem Blockwerk unterhalb der Kletterstelle bei VP42 sowie in der weiterziehenden, unschliefbaren Strecke am Höhlenende bei VP49. Im Süd-Ast wurde Tropfwasser in der hohen Kluft bei VP18 beobachtet, außerdem herrscht in diesem Bereich eine deutlich kühlere Raumtemperatur als in der übrigen Höhle. Im Gangabschnitt zwischen VP24 und VP25 befindet sich an der östlichen Raumbegrenzung, neben dicken Lehmauflagen eine kleine Wasseransammlung. Auch hier sind mit unschliefbaren Spalten einige Abflussmöglichkeiten vorhanden.
Wetterführung: Es wurde nur an einer Stelle eine Wetterführung festgestellt, und zwar bei der unschliefbaren Engstelle bei VP54 im aufwärtsziehenden Canyon des Höhlenteils "Überlagerung". Der Luftzug ist hier einwärts gerichtet (), weist aber möglicherweise auf eine Tagöffnung in der nahegelegenen Felswand hin.
Knochenfunde: In der Eingangskammer wurden im Bodenblockwerk etliche Knochen, darunter zwei große Backenzähne aufgefunden. Diese wurden an Hr. Prof. Rabeder übermittelt und dankenswerterweise wie folgt bestimmt (e-mail Mitteilung an Lukas Plan am ):
Rezente Knochen: Oberkiefer links mit den Zähnen P2-M2 vom Reh (Capreolus), 2 Oberkieferbackenzähne vom Hausrind (Bos primigenius taurus), 2 Knochensplitter von einem großen Langknochen, wahrscheinlich Rind.
Am Höhlenende bei VP48 ist an der östlichen Raumbegrenzung der Schädel eines Kleinsäugers (ev. Dachs) in den Lehm eingebettet.
Zoologische Beobachtungen: Sehr vereinzelt konnte in der Höhle bei den Vermessungstouren die eine oder andere Fledermaus beobachtet werden, jedoch ohne genauere Bestimmungsmöglichkeit. Wesentlich gehäufter traten in vielen Teilen der Höhle regelrechte "Weberknechtteppiche" an Wänden und Decke auf, insbesondere im Süd-Ast. In der Wasseransammlung bei VP49 konnte am ein kleiner Krebs (Niphargus?) gesichtet werden.
Erforschung und Vermessung:
Die Auffindung der Höhle glückte am bei einer Geländebegehung durch W. Fischer, auch konnten dabei bereits etliche Zehnermeter erkundet werden. Die erste Vermessungstour am durch R. u. W. Fischer erbrachte 145 m an Ganglänge (VP1-VP40). Der Abschluss der Bearbeitung am durch E. u. G. Herrmann (Fotodokumentation), Ch. Gegenhuber und R. u. W. Fischer ergab einen Ganglängenzuwachs von 72 m (VP41-VP66).
Literatur:
- FISCHER, W. - LERCHECKER, G. (2013): Die Daglis-Quellhöhle im östlichen Dürrensteingebiet (Teilgruppe 1815). Höhlenkundl. Mitt., Wien, 69 (11/12), S. 139 ff.
Internet:
- Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich - Forschungen & Berichte November 2015 - Dem Winter noch eine Höhle wegschnappen : http://www.cave.at/ex/tour?id=146